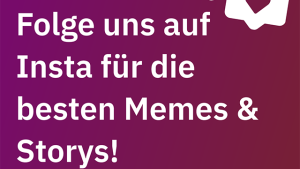Franz ist 50 und liebt seinen Job. Von seinen ArbeitskollegInnen bekommt er Anerkennung, der Job gibt ihm Halt, Routine und Selbstbewusstsein. Franz beliefert soziale Wohneinrichtungen in Wien mit Notwendigkeiten wie Klopapier und Desinfektionsmittel. Wie viele andere Menschen in Österreich darf Franz aber während der Corona-Isolation im Frühjahr 2020 seiner Arbeit nicht nachgehen.
Franz lebt mit einer Lernbehinderung und psychischen Erkrankungen. Er kann schwer verstehen, dass es nicht seine Schuld ist, momentan nicht arbeiten zu dürfen. „Habe ich keine gute Arbeit gemacht? Hat es mit mir zu tun?“: Das sind Fragen, die ihn vor allem in den ersten Tagen der Corona-Isolation ständig plagen. Seit der Isolation werden seine psychischen Probleme schlimmer, es tauchen zusätzliche gesundheitliche Probleme auf, etwa Hautirritationen.
Franz ist einer von 1,4 Millionen ÖsterreicherInnen mit Behinderung, die in der Corona-Krise besonders leiden. Tagesstrukturen, in denen viele behinderte Menschen arbeiten, finden nicht statt. Besuche in Wohneinrichtungen sind zunächst untersagt.
Für dich ausgesucht
„Fast jeder Mensch findet es schlimm, soziale Kontakte so stark einzuschränken“, erklärt Laura. Sie ist diplomierte Sozialbetreuerin und arbeitet in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen in Wien. „Menschen mit Behinderung haben in den meisten Fällen ohnedies ein sehr marginales soziales Netzwerk. Wenn das noch weiter minimiert wird, ist das für viele wirklich eine Katastrophe“, so Laura.
Laura begleitet die Bewohner und Bewohnerinnen der WG, auch Franz ist einer von ihnen, in ihrer Freizeit, nimmt Arzt- und Amtstermine wahr und kümmert sich um administrative Aufgaben. „Wann kann ich endlich wieder arbeiten?“, fragt Franz regelmäßig. Die 35-Jährige hat darauf keine Antwort, denn die Regierung hat in ihren Corona-Regelungen kaum Rücksicht auf Menschen mit Behinderungen genommen.
Die KlientInnen sind einen geordneten Alltag gewohnt: Tagesstruktur, Freizeitprogramm, Abendessen, Medikamenteneinnahme, Schlafengehen. „Sobald hier eine Komponente wegfällt, bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Viele Bewohner und Bewohnerinnen sind unruhig und verunsichert“, erklärt Laura die Probleme der vergangenen Monate.
Als die Regierung die Isolation verkündet, hält Laura es nicht für möglich, dass die Beschränkungen auch für Menschen mit Behinderung gelten sollen: „Ich hätte nie gedacht, dass ihnen das angetan wird. Dass ihnen so viele hart erkämpfte Rechte abgesprochen werden – das war für mich das Allerschlimmste. Es wurde ein allgemeines Gesetz beschlossen, aber wie das für Menschen aussieht, die dann nicht regulär an der Gesellschaft teilnehmen können, hat niemand besprochen.“
Für dich ausgesucht
Laura ist es wichtig, mit ihren KlientInnen so viel wie möglich nach draußen zu gehen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, in der Gesellschaft präsent zu sein. „Vor allem gehörlose Menschen, die in der Kommunikation besonders auf Mimik angewiesen sind, haben damit Probleme, wenn alle anderen eine Maske tragen“, kritisiert Laura. „Wieso hat da niemand dran gedacht?“ Viele Menschen mit Behinderung sind nicht in der Lage, eine Maske aufzubehalten. Mit der zweiten COVID-19-Lockerungsverordnung kommt schließlich die Ausnahmeregelung von der Maskenpflicht für „Personen, denen aus gesundheitlichen Gründen das Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann.“
Das größte Problem sieht Laura darin, wie unsere Gesellschaft tickt: Wären Menschen mit Behinderung mehr in die Gesellschaft integriert, dann würde nicht „ständig auf sie vergessen“: „Das ist eine soziale Bevölkerungsgruppe, die auch nie Thema in den Medien ist. Dass niemand darüber redet, ist das Schlimmste“, beklagt sie.
Christina, die als Behindertenbetreuerin in einer ähnlichen Einrichtung in Niederösterreich arbeitet, wünscht sich vor allem mehr finanzielle Ressourcen: „Die Menschen leben in großen Gruppen. Wären es kleinere Wohneinheiten, wäre vieles einfacher.“ Die KlientInnen in der WG, in der die 27-Jährige arbeitet, haben unterschiedliche Bedürfnisse: Manche haben sehr hohen Unterstützungsbedarf, kommunizieren nonverbal, andere sind recht selbstständig.
Auch für sie hat sich der Alltag stark gewandelt. Anstatt der üblichen Routine ist das Haus nun tagsüber komplett voll. „Es hat mich überrascht, dass vieles trotzdem gut funktioniert. Aber natürlich hat es große Auswirkungen auf die Psyche, wenn du von früh bis spät jeden Tag mit den gleichen Menschen zusammen bist“, erzählt Christina.
„Dass es hier vermehrt zu Konflikten kommt, kann man sich vorstellen.“ Zwischen zwei Klientinnen „fliegen die Fetzen“, weil eine sich von der anderen herumkommandiert fühlt. Christina muss viele Gespräche führen, beruhigen, ablenken: „Es sind Konflikte, die es schon länger gibt, die jetzt schneller hochkochen.“ Was hilft? „Gemeinsames Blumeneinsetzen, zum Beispiel.“
„Noch nie musste ich in der Arbeit so kreativ sein wie in den letzten Wochen“, erzählt Laura. Kuchenbacken, Kochen, Ballspielen, Malen: Welcher Bewohner, welche Bewohnerin interessiert sich wofür besonders? Franz etwa mag das Schauspielen, er ist ein Entertainer, ein Künstler, der sich gerne auslebt – aber noch lieber geht er arbeiten. „Spazierengehen ist normalerweise immer mit einem Kaffeehausbesuch gekoppelt, oft kann ich nur so meine KlientInnen zum Rausgehen motivieren“, erklärt Laura. Ein Ausflug zum Cola-Automaten oder zur Parkbank dient als Ersatz.
Helga, eine Klientin von Christina, begeistert sich für Kinobesuche. Dass das momentan nicht möglich ist, versucht Christina zu erklären – die Verunsicherung ist dennoch groß. „Wieso darf ich auf einer Parkbank sitzen? Kommt das Virus nicht von oben?“, fragt Helga.
Christina und ihre KollegInnen erklären mit Hilfe von Piktogrammen, Bildern, Plakaten, Händen und Füßen. Als sich die Neuigkeiten zu Beginn der Isolation überschlagen, ist es besonders herausfordernd, die KlientInnen auf dem Laufenden zu halten. Daran will Christina niemandem die Schuld geben: „Wer konnte das schon wissen?“, räumt sie ein. Die Reaktionen der KlientInnen waren größtenteils „normale Ängste“, so Christina, „Fragen, die wir uns alle gestellt haben“.
Dass die KlientInnen informiert werden, hält auch Laura für wichtig. In ihrer WG findet jeden Dienstag und jeden Freitag eine Info-Runde statt, im Rahmen derer die neuesten Entwicklungen in einfacher Sprache kommuniziert werden. „Wir haben alle während der Pandemie einen eigenen Zugang zum Thema entwickelt. Das ist alles so wahnsinnig subjektiv, was ich meinen Klienten und Klientinnen erzählen kann“, gesteht sie ein. Laura wünscht sich, dass SpezialistInnen für Fragen von behinderten Menschen zur Verfügung stehen.
Es gibt „sehr viele offene Fragen, bevor wir irgendetwas tun“, weil die Verordnungen teilweise unklar sind. Raus geht sie momentan nur mit einzelnen KlientInnen. „Wie ist die Regelung, wenn zwölf Menschen zusammenwohnen? Darf man da gemeinsam hinaus? Viel entscheiden wir intuitiv“, räumt sie ein. Das ist gar nicht einfach: „Was kann unter das Ethos der Selbstbestimmung fallen und was sind Pflichten, Gesetze, Regeln? Durch die Corona-Krise wurde uns viel Entscheidungsfreiheit weggenommen. Die Reglementierungen gehen vor. Wir haben die Verantwortung für so viele Menschen.“
Diese Verantwortung ist für die BehindertenbetreuerInnen belastend. „Es herrscht die ständige Angst, dass ich etwas von draußen in die WG schleppe“, so Laura. Jedes Mal, wenn sie in der Früh laufen geht, habe sie ein schlechtes Gewissen. Auf Familienbesuche zuhause in Kärnten verzichtet sie: „Dafür braucht es gar keine Regelung, ich schränke mich selbst ein.“
Christina stimmt das Besuchsthema besonders nachdenklich, als es die ersten Lockerungen der Einschränkungen für die Allgemeinheit gibt und die Regelungen für ihre Einrichtung noch nicht geklärt sind. „Wieso darf ich meine Familie wieder treffen, aber ein Mensch mit Behinderung nicht? Bin ich eine Gefahr, wenn ich jemanden in meiner Freizeit treffe?“
Besuche in Christinas WG sind lange untersagt, bis das Gesundheitsministerium Ende Mai „Empfehlungen zur Lockerung der COVID-19-bedingten Einschränkungen in den Einrichtungen und Programmen der Behindertenhilfe der Länder“ herausgibt. Seitdem dürfen die WG-BewohnerInnen ihre Angehörigen wieder treffen – mit Abstand, Desinfektion und nur im Garten. Bei den Familien ist das Verständnis groß, dass keine externen Personen die WG betreten dürfen, es wird viel telefoniert.
Für dich ausgesucht
Was passiert, wenn jemand sich mit dem Virus infiziert, ist lange Zeit unklar. „Werden wir dann heimgeschickt? Muss ich dann in der WG wohnen?“: Christinas Gedanken überschlagen sich. Einen Monat nach Beginn der Isolation gibt es endlich einen Notfallplan: Sollte ein Klient oder eine Klientin Symptome zeigen, kommt er oder sie in Zimmerquarantäne. Jemand aus dem Personal begleitet ihn oder sie in Schutzmontur - bis zum Testergebnis. Im schlimmsten Fall müssen Christina und ihre KollegInnen auch „freiheitsbeschränkende Maßnahmen“ setzen, sprich: Einsperren. „Wir können nicht zulassen, dass das Virus sich im ganzen Haus verbreitet, das wäre der Worst Case“.
Das Argument, dass Risikogruppen prinzipiell zuhause bleiben sollten, damit die restliche Bevölkerung sich nicht einschränken muss, stößt bei Christina auf Unverständnis. „Ich will auch meine Oma nicht einsperren. Es geht hier ja nicht um eine Woche, sondern um mehrere Monate. Es kann nicht rechtens sein, behinderte Menschen einzusperren.“ Auch für Laura hat dieser Ansatz einen bitteren Beigeschmack: „Einfach alles wegsperren, was nicht resistent genug ist? Das halte ich für ganz, ganz problematisch.“
Ab dem Sommer sollen Tagesstrukturen wieder vereinzelt stattfinden, wenn alle Verordnungen umgesetzt werden können. Franz hofft fest, dass er dann endlich wieder arbeiten gehen darf.
*alle Namen geändert